MOIST - Erfassung degradierter Moorflächen Österreichs und Beurteilung ihrer Eignung zur Regeneration
Zusammenfassung
Mehr als 90 % der ursprünglichen Moorflächen wurden in Österreich durch Entwässerung land- und forstwirtschaftlich nutzbar gemacht. Infolge der unumkehrbaren Torfzersetzung wird CO2 freigesetzt. In Österreich ist Lage und Ausbreitung von entwässerten (degradierten) Mooren nur teilweise bekannt. Im Projekt MOIST sollen als Grundlage für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung Torfböden und andere Böden mit Wasserüberschuss (hydromorphe Böden) österreichweit erfasst, beurteilt und die zur Wiedervernässung geeigneten Flächen ausgewiesen werden.
Projektbeschreibung
Moore sind Ökosysteme, in denen der Boden ständig mit Wasser gesättigt ist. Sie bieten Lebensraum für viele seltene und speziell an diese Ökosysteme angepasste Tier- und Pflanzenarten. Moore haben eine große Bedeutung im Klimaschutz, da sie wichtig für den Wasserhaushalt sind und große Mengen an Kohlenstoff speichern.
Durch Entwässerung wurde ein Großteil der Moore in Österreich für die Land- und Forstwirtschaft nutzbar gemacht. Zunehmend setzen auch Tourismus, Siedlungstätigkeiten und Klimawandel diese sensiblen Systeme unter Druck. Der zurückbleibende Torfboden enthält keine torfbildende Vegetation mehr. Mit der Trockenlegung tritt Sauerstoff in den Boden ein. In diesen entwässerten (degradierten) Mooren wird der Torf (abgestorbene Moorvegetation) zersetzt und CO2 freigesetzt.
Wiedervernässungen von Torfböden bewahren den gespeicherten Kohlenstoff vor dem Abbau und schützen den Lebensraum gefährdeter Tiere und Pflanzen. Zudem ist für den Schutz und die Instandhaltung noch vorhandener Moore ein angepasstes Management der umliegenden Flächen notwendig. Daher sehen zahlreiche Abkommen, Strategien und Regelwerke die Wiedervernässung von degradierten Mooren zur Klimawandelmilderung und -anpassung, sowie zur langfristigen Sicherung der Biodiversität und der Ökosystemdienstleistungen vor (Weltklimarat IPCC, EU-Wiederherstellungsverordnung, Biodiversitätsstrategie Österreich 2030, Moorstrategie Österreich 2030+).
Um die Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Moore erfolgreich umsetzen zu können, ist es wichtig, Informationen über das Flächenausmaß und die Verbreitung von organischen Böden zu erlangen. Während Moore oft geschützt sind und ihre Lage bekannt ist, ist das Flächenausmaß von Torfböden bislang nicht genau erfasst. Offizielle Erhebungen sind teilweise veraltet und Waldstandorte wurden dabei unzureichend berücksichtigt. Zudem gibt es Erhebungslücken oberhalb der Baumgrenze.
Das Projekt MOIST beantwortet folgende Fragen:
- Wo befinden sich degradierte Moorflächen (Torfböden und andere hydromorphe organische Böden)?
- Welches Flächenausmaß umfassen sie?
- Welche Flächen eignen sich aus fachlicher Sicht für Renaturierungsmaßnahmen?
Um diese Fragen zu beantworten werden vorhandene Karten und Daten zusammengeführt, mit Hilfe von Fernerkundungsdaten und zusätzlichen Punktdaten aus Erhebungen verschiedener Projekte ergänzt und eine Torfbodenverdachtsfläche modelliert. Diese wird durch Felderhebungen validiert und ergänzt. Außerdem wird ein Katalog an Kriterien zur Beurteilung der Möglichkeit zur Renaturierung (Wiedervernässung) mit Expert:innen und Stakeholdern entwickelt. Mit Hilfe dieser Kriterien wird eine Karte erstellt, welche Flächen ausweist, die sich aus naturschutzfachlicher, bodenkundlicher und hydrologischer Sicht für Renaturierungsmaßnahmen eignen.
Nutzen des Projekts
Die erstellte Karte dient als Grundlage für langfristiges Monitoring von Mooren und Torfböden sowie für Diskussionen und Entscheidungsprozesse in Bezug auf die Planung und Umsetzung von nachhaltigen Bewirtschaftungsmaßnahmen und potenziellen Wiedervernässungen.
Projektdetails
Projekttitel: Erfassung degradierter Moorflächen Österreichs und Beurteilung ihrer Eignung zur Regeneration
Projektakronym: MOIST
Projektleitung: AGES, Dr. Andreas Baumgarten
Projektpartner: Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW-IKT), Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (HBLFA Raumberg-Gumpenstein), Naturschutzbund Niederösterreich, Universität Wien (UNIVIE), Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ), Umweltbundesamt (UBA)
Finanzierung: Biodiversitätsfonds Call#2 des BMK (Auftragsnummer C321085)
Projektlaufzeit: 01.2024 – 10.2025
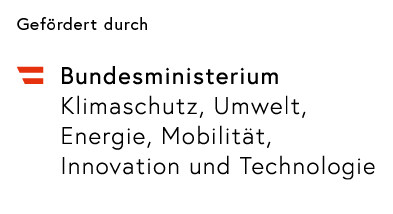

Weitere Informationen
Aktualisiert: 04.09.2024